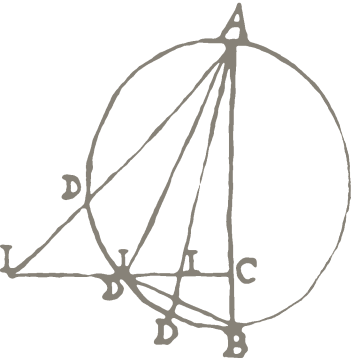Als eine der ersten Geisteswissenschaften begann sich die Philosophie mit dem Präfix „Neuro-“ zu schmücken. Die in den achtziger Jahren aus der analytischen Philosophie des Geistes hervorgegangene Neurophilosophie beansprucht seither, philosophische Fragen mit Hilfe empirischen Wissens aus der Hirnforschung zu klären. Heute erforscht beispielsweise das Schlaflabor des finnischen Philosophen und Neurowissenschaftlers Antti Revonsuo die Natur des Bewusstseins anhand von Träumen. Am Beispiel dieser Schnittstelle von Traumforschung und Neurophilosophie untersucht eine wissenschaftsanthropologische und -historische Studie, wie jahrhundertealte philosophische Fragen jetzt operationalisiert und durch Laborexperimente beantwortet werden sollen. Diese Studie war Teil des „Cerebral Subject“-Projekts von Abteilung II des MPIWG und wurde von der „European Platform for the Life Sciences, Mind Sciences, and the Humanities“ der Volkswagen-Stiftung gefördert.
Als Patricia Churchland 1986 mit ihrem gleichnamigen Buch den Begriff der Neurophilosophie prägte, definierte sie diesen neuen Ansatz in Abgrenzung von der Philosophie der gewöhnlichen Sprache. Es interessiere sie nicht, was jemand mit der Rede vom „freien Willen“ meine. Sie wolle vielmehr wissen, ob wir tatsächlich über einen solchen verfügten. Wie die experimentellen Psychologen, die um 1900 jeden fünften deutschen Philosophie-Lehrstuhl inne hatten, ging Churchland davon aus, dass Antworten auf die Fragen der Philosophie des Geistes nicht im Lehnstuhl, sondern im Labor zu finden seien. Statt auf Sprachanalysen in der Tradition Wittgensteins setzte sie auf die Neurowissenschaften. Denn der Geist, so Churchland, ist das Gehirn.
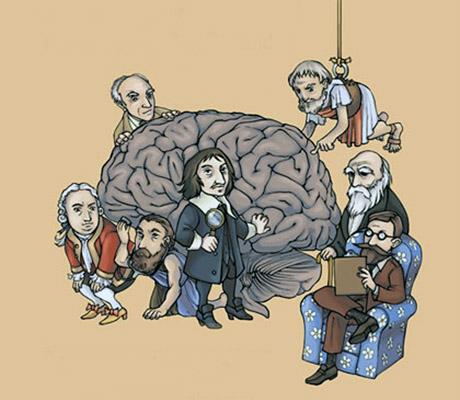
Abb. 2: Abbildung des Buches von Patricia Churchland: Brain Wise - Studies in Neurophilosophy, veröffentlicht von MIT Press (2002).
Diese Identifikation des Menschen mit seinem Gehirn, die im Rahmen des „Cerebral Subject“-Projekts am MPIWG historisch und sozialwissenschaftlich erforscht wird, ist eng mit der Geschichte der Traumforschung im 20. Jahrhundert verbunden. Die Entdeckung, dass das menschliche Hirn auch im Schlaf elektrophysiologisch höchst aktiv ist, trug Ende 40er Jahre maßgeblich dazu bei, im Hirn nicht länger ein primär auf äußere Reize reagierendes Organ zu sehen, sondern ein System, das ein hohes Maß an Eigenaktivität entfaltet.
Doch dieses in der neurophysiologischen Traumforschung seither weiter verdichtete Bild eines die Welt imaginierenden und aktiv konstruierenden homo cerebralis wurde in der Philosophie zunächst zurückgewiesen. Als der Ordinary-Language-Philosoph Norman Malcolm 1956 – drei Jahre nach der richtungsweisenden Korrelation des Träumens mit der REM-Schlafphase – Descartes' Traumskeptizismus als aus einer Begriffsverwirrung hervorgegangenes Pseudoproblem aufzulösen suchte, verwarf er die jüngsten Ergebnisse der Schlafforschung. Die Hirnströme schlafender Versuchspersonen könnten schon deshalb nicht mit Träumen in Zusammenhang gebracht werden, weil Träume nichts weiter seien als nach dem Aufwachen gegebene Traumberichte – Sprachspiele im Sinne Wittgensteins. Philosophisch seien solche laborwissenschaftlichen Studien deshalb irrelevant.
In den 1980er Jahren brach die Neurophilosophie mit der sprachanalytischen Tradition und öffnete das philosophische Denken erneut gegenüber der Erforschung des Geistes mit naturwissenschaftlichen Methoden. Die Renaissance der Bewusstseinsforschung in den neunziger Jahren bewog den finnischen Philosophen und Neurowissenschaftler Antti Revonsuo dazu, das träumende Gehirn als Modell für Bewusstsein überhaupt vorzuschlagen. Abgekoppelt von sensorischem Input und motorischem Output soll sich hier phänomenales Bewusstsein in Reinform darstellen und im Schlaflabor empirisch untersuchen lassen. In Revonsuos Augen wäre der cartesische Körper-Geist-Dualismus widerlegt, wenn sich aus neurophysiologischen Messungen rekonstruieren ließe, was eine Versuchsperson träumt. Doch gegenwärtig gelingt es dem überzeugten Monisten nicht einmal, elektroenzephalografisch zu bestimmen, ob ein Schläfer in der REM-Phase bei Traumbewusstsein ist. „Bislang haben wir Descartes nicht widerlegen können“, räumt Revonsuo ein.
Obwohl die Neurophilosophie den Anspruch erhebt, eine Form philosophischer Reflexion zu leisten, die in empirischem Wissen gründet, operiert sie zwangsläufig mit wissenschaftlich ungedeckten Vorannahmen – nicht zuletzt mit der noch immer nicht bewiesenen Identität von Gehirn und Geist, auf der das gesamte neurophilosophische Projekt basiert. Die hier vorgestellte wissenschaftsanthropologische Forschung geht unter anderem der Frage nach, wie bei diesen Grenzgängen zwischen Wissenschaft und Philosophie mit Nicht-Wissen umgegangen wird. Welche Rolle spielen „theoretische Metaphern“ in einer empirisch orientierten Philosophie des Geistes? Wie werden Science-Fiction-artige Gedankenexperimente gebraucht, um die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis im philosophischen Argument zu überwinden? Und was geschieht mit philosophischen Fragen bei dem Versuch, sie in Experimenten zu „operationalisieren“?
Methodisch basiert die am MPIWG durchgeführte Studie nicht nur auf der Auseinandersetzung mit publizierten Texten, sondern auch auf teilnehmender Beobachtung einer an Revonsuos Labor angeschlossenen Arbeitsgruppe von Hirnforschern und Neurophilosophen. Die ethnografische Untersuchung interdisziplinären Miteinanders konzentriert sich auf die Frage, was mit Begriffen und Forschungspraktiken geschieht, wenn sie zwischen unterschiedlichen Wissenskulturen hin und her wandern. Insofern der sie beobachtende Wissenschaftsforscher und die Philosophen gleichermaßen den Lehnstuhl verlassen haben, um in die zeitgenössische Laborpraxis einzutauchen, bietet diese von der Volkswagen-Stiftung geförderte Zusammenarbeit darüber hinaus Gelegenheit zum Nachdenken über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von wissenschaftsanthropologischen und neurophilosophischen Laborerfahrungen.